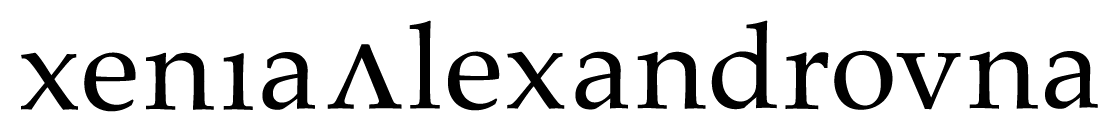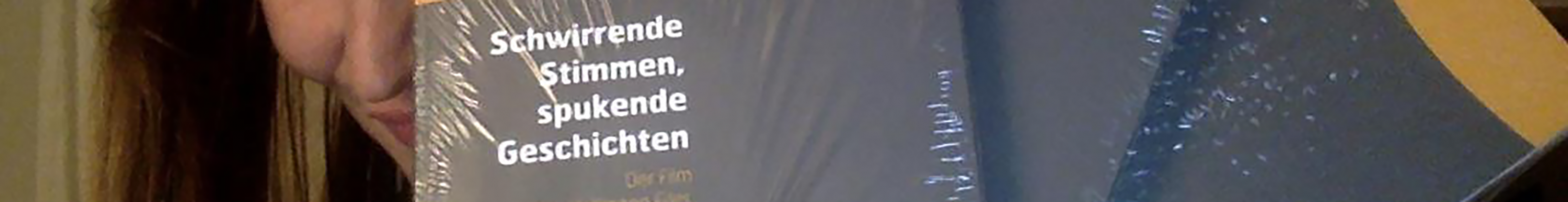Der Film The Halfmoon Files handelt von der Suche nach dem ehemaligen Kolonialsoldaten Mall Singh, der im Ersten Weltkrieg im ›Halbmondlager‹ in Wünsdorf bei Berlin interniert war. Geblieben ist von ihm eine Audioaufnahme sowie eine Karteikarte mit der Angabe einiger weniger Personalien. Der Film ist eine Revision über den Status von Protagonist∼innen im Film, über die Relation von Stimme und Bild, über die Mächtigkeit des Erzählens, über die Unabgeschlossenheit geschichtlicher Ereignisse und über die Gegenwärtigkeit von Geistern der europäischen Vergangenheit.

THE HALFMOON FILES (THF) beginnt mit dem raschelnden Geräusch von Papier. Irgendwann ertönt ein knackendes Türschloss, eine Tür wird geöffnet und der vorhandene Raum lässt sich akustisch erahnen. Das typische Knistern einer Schellackplatte ist neben einer Stimme zu hören, die im Rhythmus einer fremden Sprache erzählt. Vielleicht handelt es sich um ein Gedicht. Ich kann es nicht sagen, da ich meine Augen geschlossen halte und daher keine Untertitel lese. Durch die bewusst gesetzte Beschränkung auf das Hören kann ich den mir bereits vertrauten Film neu erfahren: Im Film gibt es eine längere Sequenz ohne Tonspur. Die Stimme Philip Scheffners hört auf zu erzählen und auch die Umgebungsgeräusche verstummen. Ohne die Bilder, u.a. eine Tanzszene, betrachten zu können, dauert die Stille eine gefühlte Ewigkeit an. Tatsächlich vergehen 7 Minuten und 10 Sekunden ohne Ton (THF: 00:36:58-00:44:08).
Ähnlich beschreibt Philip Scheffner im Interview eine Veränderung seiner Wahrnehmung beim Hören der aufgezeichneten Stimmen im Berliner Lautarchiv – er beschreibt einen Moment, indem diese Stimmen den ihn umgebenden Raum verwandeln: »Was mich an dem Lautarchiv fasziniert hat, ist das Körperliche dieser Tonaufnahmen, wie sich der Raum verändert, wenn man diese Stimmen hört, wenn jemand ganz direkt zu einem spricht« (Scheffner 2016: S. 86).
Scheffners Sound- und Filmarbeit im post/kolonialen Kontext
Neben der Auflistung einer ausgewählten Filmografie auf der Homepage zu THF finde ich eine Auswahl an Audiofiles, die Scheffners Affinität zum Hören deutlich hervorheben. Bereits seit 1986 arbeitet Scheffner als Video- und Sound-Künstler in Berlin. Das Projekt »a/c« (1996-2002) zum Beispiel bildet eine Art akustische Hörreise, die sich zwischen seiner Heimatstadt Berlin und dem heutigen Mumbai bewegt. 1Verteilt auf sieben Tracks verarbeitet Scheffner Geräusche, sphärische Klänge und Stimmen zu einem akustischen Klangteppich. Diese field recordings sind allerdings mit einer problematischen Tradition ethnographischer Klangforschung konfrontiert, die den ›Orient‹ durch Stereotype und Klischees herstellte und nach wie vor reproduziert. Als entdeckungswürdigen Ort, den es begreifbar zu machen galt, wurde der ›Orient‹ bereits im späten 18. Jahrhundert beschrieben. Die bereits etablierten Beschreibungssysteme und Wissensarchive halfen dabei die kulturelle, ökonomische und militärische Dominanz des Westens gegenüber dem ›Orient‹ zu stabilisieren. In Anbetracht dieser heute noch fortlaufenden Praxis lassen auch die Tracks von Scheffner danach fragen, wer in diesen Aufzeichnungen spricht und zu welchem Zweck überhaupt aufgenommen wurde.
Eine Verbindung von europäischer Wissensproduktion und europäischem Imperialismus hat Edward Said in seiner Analyse des Orientalismus offengelegt und dabei auch beschrieben, wie bestimmte Vorstellungen von ›orientalischen‹ Gesellschaften in den Kanon der europäischen Literatur gefunden haben. Mit diesem Schlüsselwerk der postkolonialen Theorie hat Said nicht nur die Literaturwissenschaften beeinflusst, sondern generell den Blick der Geisteswissenschaften auf kulturelle Produktionen gelenkt, in denen problematische Konstruktionen von Differenz verhandelt werden. Der ›orientalische‹ Mensch als ein Gegenbild, als der sogenannte Andere, geht einher mit der positiven Selbstkonstruktion der Europäer/innen, während mit dem Begriff ›orientalisch‹ eine breite und diverse Wissensfülle homogenisiert wird (vgl. Castro Varela / Dhawan 2015: S. 97 f.). Die Studie von Said wendet diese koloniale Perspektive und untersucht die Kolonisatoren und deren Wissensproduktion. Dabei aber, so Castro Varela und Dhawan, nimmt auch Said Homogenisierungen vor, da er versucht verschiedene Phänomene und Aspekte unter den Begriff Orientalismus zu bündeln, welcher »[…] tatsächlich aber voller Antagonismen, Aporien und Diskontinuitäten ist und zudem im eigenen Inneren vielfache und heterogene Typen beherbergt« (ebd.: S. 109). Damit es möglich wird die Kontinuität und Beharrlichkeit der westlichen Dominanzdiskurse erschöpfend herauszuarbeiten, »müsse Said alle historischen und geographischen Differenzen im Westen einschließlich ihrer spezifischen imperialistischen Formen unterschlagen oder zumindest möglichst gering halten, weswegen er kaum auf die Unterschiede der verschiedenen Orientalismen eingehe und den […] deutschen Diskurs gänzlich übergehe« (ebd.: S. 107).
Trotz seiner im Vergleich geringeren territorialen Expansion, kann der deutsche Kolonialismus, der im Film THE HALFMOON FILES behandelt wird, nicht verharmlost werden.
Der Umgang mit den ›HALFMOON FILES‹
Ursprünglich wollte Philip Scheffner für THF nach Indien fahren, er dokumentiert im Film u.a. seinen Versuch eine Drehgenehmigung zu bekommen. Ausgangspunkt für den Film ist allerdings historisches Material aus einem kolonialen Kontext: eine Sammlung von Stimmenaufnahmen indischer Kolonialsoldaten, die sich im Lautarchiv an der Humboldt-Universität zu Berlin befinden.
Während des Ersten Weltkriegs hat die Deutsche Armee kriegsgefangene Kolonialsoldaten in Speziallagern in der Nähe von Berlin interniert. Indische und afrikanische Kolonialsoldaten kamen vorwiegend in das ›Halbmondlager‹ in Wünsdorf bei Berlin. Hier wurden diese ›exotischen‹ Kriegsgefangenen auch für Forschungszwecke eingesetzt. Eines dieser Forschungsprojekte wurde von der 1915 gegründeten Preußischen Phonographischen Kommission durchgeführt. Diese Kommission, die aus 30 Wissenschaftlern aus den Bereichen Linguistik, Anthropologie und Musikwissenschaft bestand, hatte die systematische Aufzeichnung aller in deutschen Lagern gesprochenen Sprachen zum Ziel. Zwischen den Jahren 1915 und 1918 wurden unter der technischen Leitung des Sprachwissenschaftlers Wilhelm Doegen 1 650 Wachsplatten mit Sprachaufnahmen hergestellt. Annähernd hundert Jahre später fand die Kulturhistorikerin Britta Lange heraus, dass sich unter den bis dahin übersetzten Tonaufnahmen vor allem traditionelle Erzählungen, Märchen und Lieder befinden. Folkloristische und mythologische Erzählungen waren für die damalige ethnologische Forschung vorrangig interessant, da die Wissenschaftler gezielt ›typische‹ Muster für die Sprachanalyse sammelten, die als repräsentativ für eine Kultur galten (vgl. Lange 2010b: S. 3). Persönliche Zeugnisse über das Leben der Soldaten, deren Weg nach Deutschland oder Informationen über die Situation in Haft sind dementsprechend rar (vgl. Lange 2008: S. 24 f.).
In Anbetracht dieses Beispiels kolonialer Praxis, die ›wissenschaftliche‹ Klassifikationsschemata von marginalisierten Subjekten produzierte, stellt sich vor allem für den postkolonialen Film die Frage, wie mit solchem Material umzugehen ist, ohne hierarchische Verhältnisse zu bedienen oder erneut fortzuschreiben.
Der Wunsch sich für diejenigen einzusetzen, die nie zu Wort kommen, geht oft mit der Tendenz einher, deren Bedürfnisse zu definieren. In solchen Fällen agieren die Filmemacher/innen mittels einer allmächtigen Stimme (meist aus dem Off), deren Autorität nicht weiter hinterfragt wird, da sich diese Stimme um eine ›gerechte‹ Sache bemüht (vgl. Minh-ha 1998 [1993]: S. 281 f.). Mein Fokus liegt im Folgenden auf dem Sprechen, und ich gehen der Frage nach, wie eine kritische postkoloniale Repräsentation von Gesprochenem möglich ist.
Im Gegensatz zu ›der einen‹ dominanten Perspektive ist ein wesentliches Merkmal postkolonialer Erzählung das Zulassen unterschiedlicher Perspektiven, aus denen heraus erzählt wird. Die Filmwissenschaftlerin Tanja Seidel bringt postkoloniale Erzählung mit dem Essayfilm zusammen und schreibt, dass hier vor allem keine standardisierten Muster von Repräsentation bereitgehalten werden: »Instead each individual essay film refers to a particular discursive constellation expressed in a specific cinematographic language«. (2013: S. 147) In der Regel folgen die Erzählstrukturen solcher Ansätze allerdings non-linearen Erzählsträngen, die auf nicht-hierarchische Weise zusammengesetzt werden. Durch solche Herangehensweisen an die Filmsprache können Filme wiederum politisch werden: Indem Bedeutung nicht leichtfertig festgeschrieben wird und »[…] sich nicht auf eine einzige Quelle oder Autorität bezieht, sondern sie im Gegenteil entleert und dezentralisiert« (Minh-ha 1998 [1993]: S. 286). So kann der Bezug zu den tatsächlich komplex verwobenen Lebensumständen von Subjekten stets auf Neue hergestellt werden.
Im Folgenden diskutiere ich neben THE HALFMOON FILES drei weitere Filme, die postkoloniale Strategien im Umgang mit Gesprochenem umsetzten und mir Material für eine Auseinandersetzung liefern: BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN (BE 2010) von Sarah Vanagt, SURNAME VIET GIVEN NAME NAM (USA 1989) von Trinh T. Minh-ha und einen weiteren Film von Philip Scheffner: REVISION (D 2012). Gemeinsam ist diesen Filmen ein Misstrauen gegenüber vorgefertigten Bildern und Annahmen sowie eine kritische, selbstreflexiv-dokumentarische Repräsentation, die diese Filme deutlich von einer klassischen Dokumentationstradition unterscheidet, die vor allem ›authentische‹ Situationen reproduzieren möchte. Um einen Objektivitätsanspruch zu generieren, greift dieser klassisch-dokumentarische Ansatz oft auf eine umfassende Reihe an filmischen Technologien zurück: u.a. Richtmikrofone, (Lippen-)Synchronisation sowie direkte Interviewsituationen, die es ermöglichen sollen das ›wahre Geschehen‹ aufzuzeichnen (vgl. Minh-ha 1998 [1993]: S. 279 f.).
BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN
Sarah Vanagt beschäftigt sich in BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN ebenfalls mit Aufnahmen aus dem Berliner Lautarchiv. Sie arbeitet jedoch mit afrikanischen Aufnahmen, die auf die belgische Kolonialgeschichte verweisen. Der Film ist nach einer Straße im Zentrum von Brüssel, dem Boulevard d’Ypres, benannt und bezieht sich darüber hinaus auf die Stadt Ypres in Westflandern/Belgien, die im Ersten Weltkrieg ein Zentrum der Kämpfe zwischen deutschen und Entente-Truppen war. Viele der Kolonialsoldaten, die für Großbritannien, Frankreich und Russland kämpften, landeten in deutscher Kriegsgefangenschaft und wurden in Speziallagern interniert. Ein wichtiger Unterschied zu Scheffners Film ist, dass Vanagt neben den verwendeten Relikten aus dem Lautarchiv auch ihre eigenen Nachbarn – Ladenbesitzern, illegalisierte Migranten und Asylsuchende – sprechen lässt.
Mit seinen großen Lebensmittelgeschäften und seinen wirtschaftlichen Aktivitäten ist der Boulevard d’Ypres ein Anziehungspunkt für viele Menschen, die – wie die Kolonialsoldaten des Ersten Weltkriegs – oftmals gezwungen waren ihre ehemaligen Heimatländer zu verlassen. Eingebettet ist der Film in eine Phase massiver Umgestaltungen des Stadtteils, was viele der ansässigen Geschäfte an die Peripherie der Stadt verdrängt. Die dadurch leerstehenden Geschäftes- und Lagerräume funktioniert Vanagt in eine Art temporäres Filmstudio um, wo Archivmaterial aus dem Ersten Weltkrieg an die Wände der Garagentüren projiziert wird und die Bewohner der Straße zu Wort kommen.
Sowohl THE HALFMOON FILES als auch BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN vernachlässigen die Genderperspektive, was insofern nachvollziehbar ist, als Scheffner und Vanagt ihr Material aus einem Archiv beziehen, dessen ›Stimmen der Völker‹ ausschließlich männliche Stimmen von Kriegsgefangenen beinhaltet und weibliche Stimmen dort nicht gesammelt wurden. Auch andere deutsche Archive, wie das Volksliedarchiv in Freiburg, führen keinerlei bibliographische Markierungen bezüglich weiblicher und männlicher Stimmen in ihrem Bestand. Die Kulturwissenschaftlerin Claudia Schmölders stellt in Frauen sprechen hören fest, dass die Frauensprechstimme selbst in der neueren deutschen Forschung unterrepräsentiert ist: »Kurz, die Frau, die öffentlich eine Stimme im zweifachen Sinne – politisch wie physisch – besitzt, diese Stimme aber weder in Maschinen eingeflochten noch auf Unterhaltungsbühnen präsentiert vorfindet, die Frau ist in der Geschichte der Archive, jedenfalls unserer deutschen, ein seltsam blinder Fleck« (Schmölders 2012: S. 123).
SURNAME VIET GIVEN NAME NAM (SVGNN)
Im Film SURNAME VIET GIVEN NAME allerdings kommen Frauen zu Wort. Frauen, die allesamt den Vietnamkrieg erlebt haben und über ihre Familien, ihre Berufe und ihren sozialen Status sprechen. Diesen historischen Kontext teilen die Protagonistinnen mit der Filmemacherin, die während des Krieges in Saigon aufwuchs und seit ihrer Studienzeit in den USA lebt. Ab der Mitte des Films wird ersichtlich, dass die vermeintlich in Vietnam interviewten Frauen zwar vietnamesische Frauen sind, allerdings in Amerika leben, die Interviews inszeniert sind und die Texte (von der Filmemacherin) vorgegeben wurden. Diese Textvorgaben stammen ursprünglich aus dem Buch Viêtnam: Un peuple, des voix von Mai Thu Vân, in dem sie Ende der 1970er Jahre ebenfalls vietnamesische Frauen interviewt hat. Die ursprünglich auf Vietnamesisch geführten Interviews wurden zunächst ins Französische übertragen und von Trinh T. Minh-ha für den Film ins Englische übersetzt. Nach dem stellenweise stockenden Vortragen dieser vorgegebenen Texte wechseln die Darstellerinnen die Rollen und berichten über eigene Erfahrungen und die Flucht nach Amerika. Im Film wird Authentizität zunächst vorgetäuscht, um diese dann zu negieren und gleichzeitig von neuem zu behaupten. Verwoben werden die Erzählungen der Frauen mit wiederkehrendem Found-Footage Material von traditionellen Tänzen, religiösen Zeremonien, Straßen- und Marktszenen sowie Kriegsaufnahmen. Wenn der Film mit der Thematisierung von Revolution und Migration aus weiblicher Perspektive mehr Frage anreißt, als er beantworten will, dann auch deswegen, weil er eine patriarchale Praxis der Ethnografie kritisiert, die vermeintliche Objektivität und Vollständigkeit behauptet.
REVISION
Absolute Gewissheit wird es in dem letzten und zugleich neuesten Film auf meiner Liste auch nicht geben, denn REVISION ist eine Geschichte mit vielen Anfängen. Der Film handelt von einem Vorfall, der sich am 29. Juni 1992 ereignet hat: An der deutsch-polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern – die damals ebenfalls die Grenze der Europäischen Union war – werden zwei männliche Leichen in einem Getreidefeld gefunden. Sie waren auf dem Weg von Rumänien nach Deutschland, als sie früh morgens erschossen wurden. Damit sind die Männer »[…] zwei der 14 689 Einwanderer, die zwischen 1988 und 2009 an der Grenze der EU starben – so die in der Presse berichteten Zahlen der NGO Fortress Europe« (Wolf 2012: o.S.). Zwanzig Jahre später wird der Hergang der Tat von Philip Scheffner und der Autorin Merle Kröger (Roman, Drehbuch und Produktion) minutiös rekonstruiert. Dazu werden alle auffindbaren Zeug/innen befragt und es kommen erstmals die Familien der toten Väter und Ehemänner zu Wort. Das drastische Scheitern der damaligen juristischen Aufarbeitung der Tat wird alleine dadurch schon deutlich, dass die Hinterbliebenen im Grunde nur über den Tod ihrer Angehörigen informiert wurden und keinerlei weitere Informationen über die anschließenden Ermittlungen bzw. den Prozess erhalten hatten. Nach Einsicht der Akten wurde für den an den Recherche für den Film beteiligten Rechtsanwalt Wolfgang Heiermann klar ersichtlich, dass mangelhaft ermittelt wurde. Nach so einer langen Zeit konnten die Lücken in den Ermittlungen allerdings nicht mehr beweissicher aufgearbeitet werden, so dass Wolfgang Heiermann zufolge keine Möglichkeit mehr bestand, nochmals einen strafrechtlichen Prozess gegen die Täter anzustreben. Entgegen der Behauptung, dass auch zivilrechtliche Ansprüche nicht mehr möglich wären (REVISION: 01:32:57-01:36:10), da sich die Familien nicht ›gemeldet‹ hätten, konnte ein mittlerweile erfolgreicher Zivilprozess eingeleitet werden, der dazu führte, dass die Hinterbliebenen Ansprüche bei den Haftpflichtversicherungen der Täter geltend machen konnten. Zivilrechtlich verjähren Personenschäden erst dann, so Wolfgang Heiermann, wenn bekannt ist, wer die Täter sind. Dies wussten die Familien bis zur Information durch das Filmteam jedoch nicht.
Was eine filmische Aufarbeitung dieses Vorfalls neben diesem Aufrollen des Tatbestandes zusätzlich leisten kann, ist die Erschaffung eines Raumes, in dem die von der ›offiziellen‹ Geschichtsschreibung marginalisierten Subjekte sichtbar und hörbar werden.
Lückenhafte Sprachspiele
Das klassische Instrumentarium von Historikern und Anthropologen wurde im Zuge des linguistic turn um die Autorenperspektive, die Perspektive des Lesers sowie die narrative Funktion erweitert.
Wie der italienische Historiker Carlo Ginzburg feststellt, brachte der Autor Leo Tolstoi in Krieg und Frieden noch die Überzeugung zum Ausdruck, dass nur die Rekonstruktion aller stattfindenden Handlungen ein historisches Phänomen wie den Krieg verständlich mach kann (vgl. 2013: S. 101). Dies scheint unvereinbar mit einem aktuellen Zugang zur historischen Erzählung, die Lücken und Verzerrungen ihrer Quellen anerkennt bzw. bewusst herausarbeitet. In Faden und Fährten berichtet Ginzburg, wie er sich beim Schreiben von Der Käse und die Würmer (1980) vornahm, eine Erzählung zu verfassen, »[…] welche die dokumentarischen Lücken in eine glatte Oberfläche verwandeln würden« (2013: S. 101). Ursprünglich wollte Ginzburg in dieser Erzählung die moralische und intellektuelle Vorstellungswelt des auf dem Scheiterhaufen verbrannten Müllers Menocchio anhand von historischen Gerichtsakten und Vernehmungsprotokollen rekonstruieren. Bedingt durch das Schweigen des Protagonisten bei der Befragung durch seine Ankläger ist Ginzburg mit diesem Vorhaben gescheitert. Stattdessen aber wurden gerade »[…] die Hypothese , Zweifel und Unsicherheiten zu einem Teil der Erzählung […]« (ebd.). 2 Die Ablehnung des europäischen Ethnozentrismus hat Ginzburg zu der detaillierten Analyse von begrenztem Quellenmaterial geführt, aus der heraus er Zusammenhänge entwickelt. Seinen »[…] Betrachtungsmaßstab zu reduzieren bedeutet, in ein Buch zu verwandeln, was für einen anderen Forscher wohl nur zu einer Fußnote […] gereicht hätte« (ebd.: S. 100). Ginzburg war Ende der 1970er Jahre Mitglied einer Gruppe italienischer Forscher, die maßgeblich an der Entwicklung der italienischen »Mikrogeschichte« beteiligt war. Deren Haltung »(…) basierte auf dem akuten Bewusstsein, dass alle Phasen, die ein Forschungsprozess durchläuft, konstruiert und nicht gegeben sind. Alle: die Identifikation des Gegenstands und seiner Bedeutung; die Ausarbeitung der Kategorien, mittels derer er analysiert wird; die Beweiskriterien; die stilistischen und narrativen Module, mit denen dem Leser die Ergebnisse vermittelt werden« (ebd.: S. 109; Hervorh. im Orig.).
Nach Jean-François Lyotard entspricht das gesamte soziale Gefüge einer sprachlichen Konstruktion, die von sogenannten Sprachspielen erzeugt wird. Hierbei greift Lyotard auf die Wittgensteinsche Sprachtheorie zurück, in der verschiedene Arten von Aussagen bestimmten Regeln folgen, um Teil eines Diskurses zu werden. Dieser Prozess der Legitimation wird in einem expliziten oder impliziten Vertrag zwischen den Spielern ausverhandelt, wobei es ohne Regeln kein Spiel gibt, wie auch Spielzüge bzw. Aussagen, die nicht den Regeln entsprechen, nicht dem definierten Spiel bzw. Diskurs angehören (vgl. Lyotard 1993: S. 39 ff.). Im Wettstreit eines Spiels bringen Spielzüge dann Gegenzüge hervor, sie können entweder reaktiv vollzogen werden oder sie sind im Stande das Kräfteverhältnis zu wenden, d.h. neue Argumentationen im Rahmen etablierter Regeln einzuführen und gegebenenfalls sogar neue Spielregeln zu entwickeln, um das Spiel dadurch zu ändern (vgl. ebd.: S. 58, 128). In der postmodernen Kultur, so schreibt Lyotard, sind durch neue elektronische Sprachen weitere Sprachspiele hinzugekommen. Das Resultat ist eine diffuse Zahl an heterogenen Sprachspielen und Regelsystemen, die sich kreuzen und antagonistisch gegenüberstehen. Ein kohärentes Narrativ produzieren zu wollen, ist kontraproduktiv geworden, womit die großen Erzählungen ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Das Prinzip eines totalisierenden Sprachspiels ist durch das System der Pluralität ersetzt, so dass die Idee der Perspektive in den Vordergrund tritt (vgl. ebd.: S. 128). Hinsichtlich dieser Krise der Erzählung könnte ein pessimistischer Eindruck gewonnen werden, denn niemand spricht alle diese Sprachen (vgl. ebd.: S. 120). Doch entgegen der Kritik an der Postmoderne – diese sei schlicht durch Chaos und Beliebigkeit gekennzeichnet – plädiert Lyotard für eine Umgestaltung der Gesellschaft, die in der Lage ist, die reale Diversität der Menschen anzuerkennen. Im Sinne einer Übereinkunft von Sprachspielen mit heterogenen Regelsystemen befürwortet er einen lokalen Konsens, der vor allem zeitlich begrenzt ist (vgl. ebd.: S. 191).
Eurozentristischer Feminismus und postkoloniale Texte
Einhergehend mit dem Ende der großen Erzählungen wird auch der Identitätsbegriff in Frage gestellt. Chandra Talpade Mohanty thematisiert in ihrem Aufsatz Under Western Eyes; Feminist Scholarship and Colonial Discourses das Problem einer globalen weiblichen Identität, die in hegemonialen Diskursen wie der traditionellen Anthropologie, Soziologie und Literaturkritik behauptet wurde. Die Repräsentation von historischen weiblichen Subjekten durch die Kategorie ›der Frau‹ impliziert eine zusammenhängende Gruppe mit gleichen Interessen und Wünschen, die sich auf eine homogene Identität zurückführen lässt und darüber hinaus auch universell und kulturübergreifend wirkt. Spiegelbildlich dazu steht die Vorstellung einer universell gültigen männlichen Dominanz bzw. die umfassende patriarchale Unterdrückung ›der Frau‹. Dabei wird das Bild einer ›Dritte-Welt-Frau‹ abgeleitet, die als »[…] ignorant, poor uneducated, tradition-bound, domestic, familiy-oriented, victimized, etc.« gedacht wird. »This, I suggest, is in contrast to the (implicit) self-representation of Western women as educated, modern, as having control over their own bodies and sexualities, and the freedom to make their own decisions« (Mohanty 2003: S. 22). Diese negativ konnotierte Vorstellung einer ›Dritte-Welt-Frau‹ geht also einher mit der positiven Selbstbestimmung der ›westlichen Frau‹. An dieser Stelle sei auch auf das Paradox hingewiesen, dass einerseits die Heterogenität von Frauen des globalen Südens, Schwarzen Frauen, transgender und queeren Subjekten betont wird, anderseits die Frauen der ›Ersten Welt‹ wiederum homogenisiert werden. »My reference to ›Western feminism‹ is by no means intended to imply that it is a monolith. Rather, I am attempting to draw attention to the similar effects of various textual strategies used by writers that codify others as non-Western and hence themselves as (implicitly) Western« (Mohanty 2003: S. 18).
Auch die feministische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak hat den westlichen Feminismus kontinuierlich kritisch hinterfragt und das Vorhandensein einer ›globalen Schwesterlichkeit‹ angezweifelt. In dem Essay French Feminism in an International Frame verweist Spivak auf den Zusammenhang von Imperialismus und Feminismus. In diesem Essay wird Julia Kristevas selbstkonstituierender Beitrag in About Chinese Women kritisiert, der Spivak zufolge von Kristevas eigener Identität bzw. einer westlichen Subjektivität handelt, denn das Interesse Kristevas für die matriarchale Gesellschaftsorganisation in China [matrilineal and matrilocal society, Spivak 2006: S. 189] lässt die sozialen und politischen Situationen heutiger chinesischer Frauen außer Acht. Die generalisierende Repräsentation unterschiedlicher Lebenserfahrungen muss demnach als epistemischer Gewaltakt gesehen werden, wobei vor allem diejenigen Gewalt erfahren, die von den machtvollen Diskursen pauschalisiert und damit auch assimiliert werden (vgl. Castro Varela / Dhawan 2015: S. 185).
Spivak behauptet, dass das, was von bestimmten Bevölkerungsgruppen artikuliert wird, nicht immer gehört wird, und fragt in Can the Subaltern Speak? (2008), ob die Subalterne überhaupt sprechen kann. Mit ›Sprechen‹ bzw. speak meint sie explizit eine aktive Verbindung zwischen Sprecher/in und Hörer/in, wobei Sprechen und Hören den Sprechakt erst wirklich vervollständigen (vgl. Spivak 2008 S. 127). Hinsichtlich der Subalternität bezieht sich Spivak vor allem auf indische Frauen, die von indigenen wie fremden Eliten zum Schweigen gebracht wurden (vgl. ebd.: S. 101, 121). Mit ihrer Auseinandersetzung knüpft sie an den Ansatz der indischen Subaltern Studies Group an, welche u.a. versucht, die ungehörten Stimmen subalterner Gruppen durch Archivarbeit zu rekonstruieren. Die Arbeiten von dieser Gruppe wurden von der allgemeinen Historiographie Indiens jedoch nicht anerkannt, was ein weiteres Beispiel dafür liefert, dass die Subalternen sich kein Gehör verschaffen können (vgl. ebd.: S. 127). »It is only the texts of counterinsurgency or elite documentation that gives us the news of the consciousness of the subaltern« (Spivak 1996: S. 203).
Da die kulturelle Repräsentation eine Vorbedingung für eine politische Repräsentation darstellt (vgl. Spivak 2008: S. 13), kann Spivaks Beschäftigung mit den postkolonialen Erzählungen von Mahasweta Devi, welche Ereignisse aus der indischen Geschichte aufgreift, als eine Intervention in das Schweigen der britischen Archive betrachtet werden (vgl. Castro Varela / Dhawan 2015: S. 160). Bei ihrem Bemühen um eine internationale Verbreitung der Erzählungen von Devi – ursprünglich waren sie nur Leser/innen der bengalischen Sprache vorbehalten – wurde Spivak jedoch für das Englisch ihrer Übersetzungen kritisiert, einer Sprache der Macht, welche die Identität von politisch weniger mächtigen Menschen zu vernachlässigen droht. Sie äußert sich dazu im Vorwort zu Devis Erzählungen: »(…) This is an interesting question, unique to India: should Indian texts be translated into English of the subcontinent?« (Devi 1995: S. 28).
Ein verantwortliches Handeln – das keine Lösungen sucht, die schnell Gutes bewirken sollen – bedeutet Spivak zufolge weder das über noch das für jemanden Sprechen. Ihrer Ansicht nach stellt ausschließlich das Miteinander-Sprechen Handlungsfähigkeit her (vgl. Spivak 2008: S. 129). In dieser Form von Dialog wird der Blick auf ein gemeinsames Zuhören gerichtet, wobei auch die visuellen und akustischen Ebenen, die unsere Sinne jenseits von Identität besetzen, eine Rolle spielen (vgl. Bergermann / Heidenreich 2015: S. 27). Eventuell deshalb fordert Spivak Castro Varela und Dhawan zufolge eine transdisziplinäre und transnationale Kulturwissenschaft, die sich den Auswirkungen des (Neo-)Kolonialismus stellt (vgl. 2015: S. 155). Die Postcolonial Studies müssten sich also verstärkt einer medienwissenschaftlichen Perspektive öffnen, damit sich die Disziplin noch mehr als bisher gegenseitig herausfordern, bereichern und damit sie neue Erkenntnisse produzieren. In ihrem Vorwort von Postcolonial Studies meets Media Studies bemerken die Autor/innen, dass die Literatur in den Postcolonial Studies überrepräsentiert bleibt, obwohl ein Interesse an Medien bereits seit den 1990er Jahren artikuliert wird (vgl. Merten / Krämer 2016: S. 7).
Die Sprecher des Boulevard d‘Ypres
Der Film BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN ist ein mikrohistorisches Experiment, mit dem Sarah Vanagt auf den Alltag der Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung verweist und Geschichte ›von unten‹ erzählt. Im Film werden archivierte Stimm-Relikte aus den deutschen Kriegsgefangenenlagern des Ersten Weltkriegs nicht einfach nur abgespielt, sondern von gegenwärtigen Migranten, die in den Aufnahmen ihre eigenen Sprachen erkennen, übersetzt. Die Geschichte mit der Dateinummer PK 116-2 zum Beispiel wurde am 8. Dezember 1917 aufgezeichnet, der Erzähler – ein Kriegsgefangener aus Burkina Faso – spricht Mossi. Diese einminütige Sprachaufzeichnung wird fast ein Jahrhundert später von dem ebenfalls aus Burkina Faso stammenden Ousmane ins Französische übertragen (vgl. BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN: 00:22:33-00:22:58; Vanagt & Kwakkenbos 2010: S. 19 f.). Durch die Übersetzung überlagern sich die Stimmen der Vergangenheit mit den Stimmen der Gegenwart. Die letztlich unüberwindbare Differenz der Sprachen führen jedoch dazu, dass sich der Inhalt wandelt und in weiterer Folge eine identische Rückübersetzung unmöglich wird. »No matter how much one wants to give away, something ›sits back‹ and remains […]« (Minh-ha 2010: S. 26). Im Film bleibt das Original schlicht unverständlich (vgl. BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN: 00:21:26-00:21:55). Da die Übersetzer aber in der dritten Person sprechen – »That’s what he says« (ebd.: 00:20:47) –, gerät die Übersetzung auch zur Nacherzählung. Dabei kann die Ungenauigkeit der Worte jedoch nicht nur als Beschränkung oder Mangel gesehen werden, sondern auch als Erweiterung, da die Erzähler ihr eigenes Wissen über die historischen Hintergründe des Erzählten einbringen. Schließlich beginnen sie entgegen des Scripts von ihren eigenen Geschichten zu berichten, sie werden von der Filmemacherin allerdings dazu angehalten auch weiterhin in der dritten Person zu sprechen: »So the story is good like I told it, but I should say ›once upon a time there was a boy‹ and then…[?]« (BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN: 00:03:20-00:03:25).
Was passiert jedoch, wenn die Erzählung vom eigenen Leben durch eine Verlagerung auf eine rein sprachliche Ebene funktioniert bzw. depersonalisiert wird? Manche Sprecher sind möglicherweise erst durch das Verlassen der Ich-Perspektive dazu in der Lage, über traumatische Erlebnisse zu sprechen. Darüber hinaus eröffnet sich ein Raum, in dem sie nicht auf ihre Opferrolle reduziert werden und als selbstermächtigte Vermittler historischer Ereignisse und subjektiver Erfahrungen agieren. Einer der Sprecher äußert allerdings folgenden Einwand: »I’m going to think about it, because … . How can you tell a story of the street as a fairy tale?« (BOULEVARD D’YPRES / IEPERLAAN: 00:00:49-00:00:59). Ein älterer Taxifahrer, der den Algerienkrieg miterlebt hatte und den Vanagt bereits einige Jahre kennt, wollte im Film gar nicht erst vorkommen: »I can’t say: ›Once upon a time…‹ It’s my story. I can only say ›I‹« (Vanagt & Kwakkenbos 2010: S. 26).3
Vielstimmige Performance in SURNAME VIET GIVEN NAME NAM
Der weiter oben bereits skizzierte Aufbau des Films SVGNN stellt Authentizität in einem Wechselspiel von Realem und Inszenierung zur Diskussion und erprobt eine kritische Interviewpolitik. Im ersten Teil des Films werden die Interviews zunächst so gestaltet, dass sie ›authentisch‹ wirken, wobei im Laufe des Films die zugrunde liegende Inszenierung immer offensichtlicher wird, bis eine Reihe ›realer‹ Interviews gezeigt wird. Durch die Konfrontation von inszenierten Interviews mit ›Live-Interviews‹ werden einerseits die formalen Unterschiede erfahrbar (Schnitt, Verwendung der Sprache, Kamera, etc.) und andererseits werden die »[…] Verhältnisse/Bedingungen/Beziehungen von Repräsentation sichtbar angesprochen« (Minh-ha 1995b: S. 89). Dabei ist nicht entscheidend, was die Frauen sagen, denn der Fokus liegt eher auf den Sprachspielen, die sie anwenden bzw. nicht anwenden. Damit gehen weitere Verschränkungen zwischen mündlichem Vortrag (einstudiert bzw. improvisiert) und den Bildtexten einher (vgl. Minh-ha 1995a: S. 67). Töne und Bilder laufen stellenweise asynchron und gegenläufig zueinander, die Untertitel erscheinen verzögert zum gesprochenen Text auf der Leinwand und die eingeblendeten Texte füllen teilweise den gesamten Bildschirm aus. Diese wechselseitigen Überlagerungen sollen keine verborgenen Zusammenhänge aufdecken, es geht vielmehr darum von einem »hybriden Terrain« (ebd.: S: 60) aus zu sprechen. Die Filmemacherin möchte nicht über etwas sprechen, sondern in der Nähe davon – »talking nearby« (vgl. Minh-ha 2010: S. 17): »Ein Sprechen also, das sich selbst reflektiert und einem Subjekt sehr nahe kommen kann, ohne es jedoch zu beanspruchen oder sich seiner zu bemächtigen« (Minh-ha 1995a: S. 68).
Michail Bachtin schlägt in seiner Studie Probleme der Poetik Dostoevskijs vor, Dostojewskis Literatur nicht als die Erzählung eines Autors zu begreifen, sondern als die Ansammlung von Stimmen verschiedener Autoren, deren unterschiedliche Charaktere und Schicksale nicht in einer einheitlichen, objektiven Welt zusammengeführt werden, sondern es wird »[…] eine Vielfalt gleichberechtigter Bewußtseine mit ihren Welten […] in der Einheit eines Ereignisses miteinander verbunden, ohne daß sie ineinander aufgehen« (1971: S. 10; Hervorh. Im Orig.). In diesem Sinne »plurivokal« gestaltet ist auch der Filmtext von Trinh T. Minh-ha (vgl. 2010: S. 19), da er permanent die Perspektive wechselt und sich erzählend hin und her bewegt. Der Film ist als ein Denkprozess zu lesen, der ein Dazwischen auslotet und dabei eine geschichtete, hybride Form von Identität verhandelt (vgl. Minh-ha 2010: S. 17).
Das ›Ich‹ ist also kein einheitliches Subjekt, keine starre Identität oder solide Masse, die mit Schichten von Oberflächlichkeiten bedeckt wäre, die man nach und nach abschälen muss, damit ihr wahres Gesicht zum Vorschein kommt. ›Ich‹ ist in sich selbst unendliche Schichten. (Minh-ha 2010: S. 163 ff.)
Die Sprecherinnen im Film haben vielschichtige sprachliche Rollen, die Erwin Goffman in seiner Publikation Rede-Weisen näher bestimmt. Ihm zufolge ist die Ethnokatergorie »Sprecher« (im Allgemeinen männlich gefasst) zu grob für eine hinreichende Analyse von Kommunikation (vgl. 2005: S. 43). Daher zerlegt er den Sprecher in kleinere Elemente bzw. Rollen: den »Animateur«, »Autor« und »Urheber«. Die Ameteur/in, gefasst als Sprechmaschine, führt die akustischen Aktivitäten aus. Die Autor/in ist diejenige die die Empfindungen auswählt, die zum Ausdruck gebracht werden sollen und die Worte, in die sie gefasst werden, wohingegen die Urheber/in diejenige ist, deren Standpunkt durch die ausgesprochenen Worte vertreten wird, deren Vorstellungen mitgeteilt werden und die sich dem verpflichtet fühlt, was gesprochen wird (vgl. ebd.: S. 59).
Im ersten Teil des Films SVGNN zitieren die Protagonistinnen andere Frauen und lernen dafür die von der Filmemacherin vorgegebenen Texte auswendig oder lesen diese vom Blatt ab. Dadurch erfüllen sie die Funktion der akustischen Äußerungsproduktion: Der Mund öffnet sich, die Lippen bewegen sich und es werden Worte hörbar. Da die Frauen beim Animieren dieses Sprechaktes nicht ihre eigenen Worte zum Ausdruck bringen, können sie nicht als Autorinnen des Gesprochenen bezeichnet werden. Jedoch tritt auf der Ebene der Animation eine Form der Urheberschaft hinzu, da die Frauen die vorgegebenen Texte auf der Basis eigener Erfahrungen mit Leben erfüllen. Treffen alle drei Rollen in einer Person zusammen, dann wird angenommen, „(…) dass die Person, die die Aussage animiert, den eigenen Text formuliert und dadurch auch ihre eigene Position bestimmt: Animateur, Autor und Urheber sind eines. Was könnte natürlicher sein“ (Goffman 2005: S. 60). Jedoch verändert sich der Status der jeweiligen Rollen innerhalb der Rede ständig und damit das Verhältnis der Sprecherrollen zueinander, was Goffman zufolge zu einem durchgängigen Merkmal des natürlichen Redeflusses gehört (vgl. ebd.: S. 42). Diese Veränderungen in der Ausprägung der Rollen werden durch paralinguistische Merkmale angezeigt, dazu gehören Sprechpausen, Sprachrhythmus, Intonation, Tonhöhe und Lautstärke der Rede. In Bezug auf die Sprechweise der Frauen im Film kann eine deutliche Veränderung beim Übergang vom ersten in den zweiten Teil beobachtet werden, da die Rolle der Autorin und Urheberin hinzutritt und sich Gestik sowie Sprache der Frauen ändern.
Im Allgemeinen stehen Sprecher/innen alle drei Rollen zur Verfügung, womit ein dynamisches und natürlich erscheinendes Sprechen möglich wird, bei dem es nicht darum geht zwischen den ›Sprechrollen‹ zu wechseln, sondern die gerade nicht im Vordergrund stehende aufrecht zu erhalten, um sie jederzeit wieder aktivieren zu können, denn: »Es muss auch keineswegs so sein, dass ein Redestrang vorherrscht und alles andere wie eine Randbemerkung ehrfürchtig an den Bruchstellen [der Rede] eingefügt werden müsste« (Goffman 2005: S. 71).
Zuhören in REVISION
REVISION ist aus Szenen aufgebaut, in denen die Protagonist/innen ihre für den Film bereits getätigten Aussagen anhören, ergänzen, kommentieren und besprechen. Neben den Familien der Opfer kommen eine ganze Reihe von Menschen vor, die sowohl auf juristischer, investigativer als auch persönlicher Ebene mit dem Vorfall konfrontiert bzw. befasst waren. Durch diese Gleichzeitigkeit von Anhören und Sprechen entstehen Situationen in denen die Sprecher/innen ausverhandeln, wie sie im Film erscheinen möchten. Durch das Wiederanhören der eigenen Aussagen ergibt sich die Möglichkeit, diese zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Der Fokus, der im Film geführten Gespräche, liegt daher auf der Reflexion, denn nur in Bezug auf die bereits getätigten Aussagen können neue hinzugefügt werden bzw. diese durch das bloße Anhören bestätigt werden. Dabei gelingt es REVISION das Hören als wesentlichen und unabdingbaren Bestandteil von Kommunikation sichtbar zu machen.
Ebenso wie bei den unterschiedlichen Sprecherrollen, lässt sich auch die Funktion des Hörens weiter aufschlüsseln. Erwin Goffman konstatiert, dass es eine Bandbreite an strukturell differenzierten Daseinsweisen gibt, die eine/n Hörer/in genauer definieren (2005: S. 51). Der bzw. die Hörer/in erfüllt eher eine Funktion innerhalb einer sozialen Situation, als dass er oder sie eine Rolle einnimmt, denn nach Goffman gibt es anerkannte und nicht anerkannte Teilnehmer/innen. Die anerkannten Teilnehmer/innen unterscheidet Goffman in angesprochene und nicht-angesprochene Rezipient/innen (2005: S. 45 ff.). Diese Ausdifferenzierung der Positionen der Hörer/innen verdeutlicht noch einmal das ignorante Verfahren der Behörden, die im Rahmen des juristischen Verfahrens den Familien der Opfer weder die Möglichkeit der Artikulation noch die Möglichkeit des Zuhörens eingeräumt haben (vgl. REVISION: 01:32:00-01:32:56). Der Film REVISION verleiht den Familien nicht nur einen Sprecherstatus, sondern räumt ihnen darüber hinaus einen Status als anerkannte Rezipient/innen der im Film getätigten Aussagen ein.
Resümee
Postkoloniale Kritik strebt eine Überwindung binärer Gegenüberstellungen an, die jedoch im Kontext eurozentristischer Wissens- und Identitätsproduktion stets aufs Neue produziert und bestätigt werden. Durch das Verflechten von Perspektiven will der postkoloniale Film multiple Identitäten und heterogene Erzählweisen erfahrbar machen. Mein Fokus lag vor allem auf dem Gesprochenen und dessen Facettenreichtum im Zusammenhang mit einem fragmentierten Selbst, das sich innerhalb multipler Kräfteverhältnisse äußert. Sich dabei nur auf die Beobachtung des Sprechens zu fokussieren, muss jedoch unzureichend bleiben, da sich die vielen unterschiedlichen Rollen der Sprecher/innen mit den vielfältigen Funktionen des/der Hörer/innen vermischen und nur dann eine weiterreichende Analyse des Gesprächs möglich ist, wenn das Soziale der Sprechersituation in die Beobachtung einbezogen wird.
Wien, 2016; ISBN 978-3-85449-4
- http://www.pong-berlin.de/de/1/sound/philip-scheffner-ac (3.5.2016) ↩︎
- Auch Philip Scheffner ist mit Lücken bzw. Fragmenten im Berliner Lautarchiv konfrontiert, da Bilder zu den besagten Tonaufnahmen fehlen (vgl. Scheffner 20016: S. 87 f). ↩︎
- Diese Aussage setzt allerdings voraus, dass das ‚Ich‘ innerhalb des Zeitflusses eine unabänderliche Entität darstellt. ↩︎